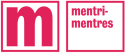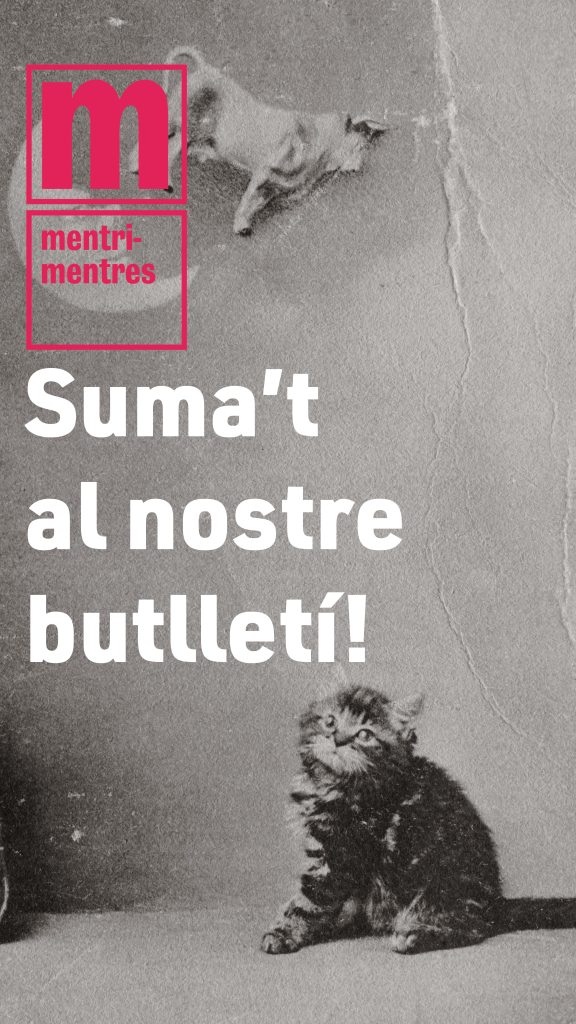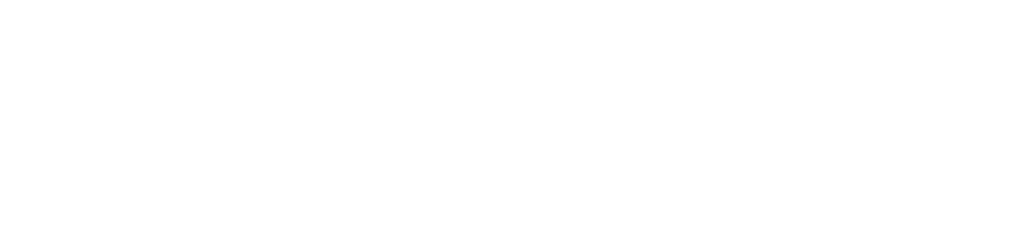Carlos Francesch
Benedict Wells: «In unbeschwerten, glücklichen Momenten gab es immer auch Sorgen: Das Leben kann in den meisten Fällen auch gar nicht anders sein.»
Ich habe mit Begeisterung Ihren neuesten Roman Hard Land (Diogenes, 2021) gelesen – in der katalanischen Übersetzung von Ramón Farré (Les Hores, 2022). Als der katalanische Verlag Les Hores mir vorschlug, ein Interview mit Ihnen zu führen, konnte ich deshalb nicht nein sagen. Besonders fasziniert hat mich, wie sich die Welt von Hard Land auf mehreren Ebenen entfaltet: durch literarische und musikalische Referenzen, durch das Aufdecken der Tiefenschichten der Charaktere, aber auch durch neue Erfahrungen – sowohl traumatische als auch glückliche –, die neue Bedeutungsebenen eröffnen.
 Fotografie von Benedict Wells, Autor von Hard Land. | Creative Commons
Fotografie von Benedict Wells, Autor von Hard Land. | Creative Commons
Nicht nur in der Handlung, sondern auch in Ihrem Stil entdecke ich eine große Ausgewogenheit: das harte Leben Hand in Hand mit der Freude an Freundschaft und Familie; eine belastende Vergangenheit neben jugendlicher Begeisterung; Erfolge und Misserfolge in Liebesbeziehungen… Ihr Buch scheint mir auf der Suche nach einem Mittelpunkt zu sein. Entspricht das Ihrer Lebens- oder Literaturauffassung?
Ich vermute: beides. In meinem eigenen Leben gab es kaum eine Phase, in der nur ein einzelnes Gefühl vorherrschte. In unbeschwerten, glücklichen Momenten gab es immer auch Sorgen und Ängste – und umgekehrt. Ich glaube, das Leben kann in den meisten Fällen auch gar nicht anders sein. Wir müssen am Ende sterben, ausnahmslos, aber wir können dem Tod bis dahin immer wieder trotzen, uns ablenken, glücklich sein. Und doch wissen wir tief in uns, dass es eines Tages zu Ende geht, dass jede Sekunde etwas passieren kann…
Diese Mischung findet sich im Großen wie im Kleinen, und das Gleiche gilt auch beim Schreiben. Ich mag zum Beispiel keine reinen Happy Ends, ich will nicht lügen. Deshalb war es mir bei Hard Land wichtig, nicht im Sommer aufzuhören, sondern auch den Winter danach zu zeigen, den wahren Schmerz in der Trauer, die Einsamkeit. Aber man kann als Autor steuern, ob man eine Geschichte an einem solch düsteren Punkt beendet oder an einem etwas leichteren. Und genauso kann man entscheiden, wie genau man beobachtet, ob man in einer traurigen Szene nicht doch auch noch etwas findet, das ein wenig Hoffnung macht. Die Ereignisse bleiben gleich, aber das Gefühl, das man den Menschen mitgibt, wird dadurch fundamental anders.
Manchmal scheinen diese Ebenen sich ins Verborgene zurückzuziehen – durch Metaphern oder durch Schweigen verdeckt. Es gibt im Buch das Motiv des Geheimnisses, wie auch in Hard Land von Morris. Sollen wir also auch in Ihrem Hard Land nach verborgenen Geheimnissen suchen?
Das Schöne beim Schreiben ist ja, dass ein Text nur ein schwarzweißer Architekturplan ist – die Gebäude errichten die Menschen, die eine Geschichte lesen; die Farben kommen von ihnen und ihrer Fantasie. Sie mischen beim Lesen eigene Emotionen und Erinnerungen bei und füllen so die halbleeren Gläser auf. Ihr Sam Turner wird vielleicht ganz anders aussehen als meiner. Und genauso werden Sie vielleicht auch andere Geheimnisse beim Lesen finden als ich es beim Schreiben tat.
Deutschland hat eine große Tradition des Bildungsromans – Wilhelm Meisters Lehrjahre (Goethe) oder Der Zauberberg (Thomas Mann). Hat diese Tradition Sie geprägt? Oder sehen Sie „Coming of Age“ als etwas grundsätzlich anderes?
Ich kann wirklich mit großer Entschiedenheit sagen: Diese deutsche Tradition hat mich überhaupt nicht geprägt (lacht). Meine frühen Heldinnen und Helden kamen eher aus dem angelsächsischen Raum, etwa Toni Morrison, Kazuo Ishiguro, John Irving, Carson McCullers, Jeannette Walls oder John Green. Vor allem die Romane von letzterem haben mich bei Hard Land inspiriert und stehen für mich eher in der Tradition von „Coming of age“ – wie auch ein wunderbares Werk wie The Perks of Being a Wallflower von Stephen Chbosky. Ich schätze die Werke von Thomas Mann oder von Goethe, aber für das Finden meiner eigenen literarischen Stimme waren die oben erwähnten Autorinnen und Autoren wichtiger. Carson McCullers und ihr Das Herz ist ein einsamer Jäger zum Beispiel haben mich unglaublich geprägt, die Art, wie sie über Einsamkeit schrieb, wie sie sich in ihre Figuren einfühlte und ihnen nahe kam. So wollte ich auch schreiben.
Hard Land ist ein hervorragendes Beispiel für einen Coming-of-Age-Roman. Ist es nur für Jugendliche und junge Erwachsene gedacht?
Vielen Dank. Und ich würde sagen: Es ist für junge Erwachsene und Jugendliche gedacht, aber mindestens so sehr für Menschen, die mal junge Erwachsene und Jugendliche waren.
Der Roman spielt in den 1980er-Jahren in Grady, einer kleinen, verfallenen Stadt in den USA. Warum haben Sie diese Kulisse für Ihren Coming-of-Age-Roman gewählt? Was hat Sie an diesem Setting besonders fasziniert?
Ich hätte natürlich auch über die Neunzigerjahre in Bayern schreiben können, die ich nur zu gut kenne – nur wäre dieser Roman dann nie entstanden, weil es mich gelangweilt hätte. Meine Tinte für Hard Land war nicht die eigene Erfahrung, sondern Sehnsucht. Als ich ein Kind war, liefen im Fernsehen die ganze Zeit amerikanische 80ʼs -Filme wie Stand By Me, Zurück in die Zukunft und The Breakfast Club. Die habe ich aufgesogen, da wollte ich immer hin. Ich kann über einen gelben Schulbus in den USA viel mehr erzählen als über den Bus im Allgäu, den ich als Heimschüler selbst benutzt habe. Gleichzeitig gab es nie eine Desillusionierung. Die 1990er in Deutschland, die ich selbst erlebt habe, gehören mir als Erzähler nicht, denn ich weiß ja, wie trist und banal es oft wirklich war – und bin durch meine Erlebnisse in meiner Phantasie limitiert. Die 1980er in Amerika dagegen habe ich zeitlich nur gestreift, sie bedeuteten für mich als Autor Freiheit.
Auf den fiktiven Ort Grady wiederum kam ich, als ich 2008 durch Amerika gereist war und dort in einem kleinen Kaff am Missouri River landete. Es ist eine eher konservative Gegend, umso mehr faszinierten mich die Gespräche mit liberalen jungen Leuten, die dort in der Minderheit waren und aus diesem Ort nicht rauskamen. Ich hatte damals schon grob die Idee der Geschichte im Kopf, und irgendwann blickte ich auf den Missouri River im Abendlicht und dachte: „Sollte ich dieses Hard Land wirklich eines Tages schreiben, dann wird es an einem Ort wie diesen spielen.“
Heute sehe ich Amerika übrigens sehr kritisch, die aktuelle Entwicklung unter Trump besorgt mich und macht mich wütend. Aber das ändert nichts daran, dass ich damals als Jugendlicher eine große Sehnsucht für dieses Land hatte. Und genauso habe ich mich als Teenager nach diesem einen großen Sommer gesehnt wie im Buch, nur leider hatte ich ihn nie. Und mit diesem Gefühl des Verpassten schrieb ich die Geschichte.
Sie waren zu jung, um die 1980er-Jahre selbst bewusst zu erleben. Wie haben Sie all die Literatur-, Film- und Musikreferenzen gefunden? Wie verlief Ihr Rechercheprozess?
Auf die für mich schönste Weise. Ich bin einerseits noch mal durch viele Kleinstädte in Amerika gereist und habe andererseits wirklich jeden einzelnen Coming-of-Age-Film der 80ʼs geschaut. Nicht nur die gut dreißig Klassiker, die man vielleicht kennt, sondern auch Filme, von denen Tom Cruise oder John Cusack vermutlich selbst vergessen haben, dass sie mal in ihnen mitgespielt haben. Daneben hörte ich unablässig Musik der Achtzigerjahre, wollte mich mit der Stimmung dieser Zeit vollsaugen. Spannend fand ich dabei, dass die Achtziger in Wahrheit eine düstere Dekade waren. Es gab den Kalten Krieg und die spürbare Angst vor einer atomaren Eskalation, Sauren Regen, Tschernobyl, Arbeitslosigkeit, Rückständigkeit; Homosexualität etwa war in den USA vielerorts verboten. Deshalb bildete die damalige Popkultur für mich eher das Gegengewicht zu all dem: ein naiver Eskapismus. Die Filme der Achtziger zeigen nicht die Realität, aber sie zeigen, wonach die Menschen sich damals wohl gesehnt hatten. Im Buch habe ich dann versucht, beides abzubilden. Die vermeintliche Unbeschwertheit, die wir aus den Klassikern und Songs kennen, aber auch den wirtschaftlichen Niedergang der Stadt Grady, die Schwierigkeiten für Außenseiter und Minderheiten.
Man merkt Ihrem Buch viel Aufwand und Liebe zum Detail an. Ohne zu viel zu verraten: Hard Land enthält sogar eine Art Abspannszene, einen Soundtrack und Zitate – was in einem Roman eher ungewöhnlich ist. Wie verlief Ihr Schreibprozess bei diesem Buch? Ist das bei anderen Projekten ähnlich?
Das verändert sich immer wieder, denn jedes Buch braucht einen anderen Zugang. Hard Land sollte sich ganz bewusst wie ein 80s-Film anfühlen, etwas Vertrautes haben. Wobei Musik etwas ist, das mich generell sehr beschäftigt. Ich habe auch für alle anderen Romane Soundtracks erstellt, nur nicht so prominent. Meine liebste Phase beim Schreiben ist es, wenn ich mir einen Kaffee hole, durch die Stadt spaziere, Songs höre, die zur Geschichte passen – und mir dabei stundenlang mögliche Szenen oder Vertiefungen für die Charaktere ausdenke. Das ist eine Art Ideenfischen.
Sie haben zwei Jahre in Barcelona gelebt. Aus katalanischer Sicht interessiert uns natürlich: Wie hat Barcelona Sie als Schriftsteller geprägt?
Es waren sogar dreieinhalb Jahre. Nach Barcelona zu ziehen, war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich habe die Stadt geliebt und liebe sie immer noch. Als Mensch haben mich diese Jahre sehr geprägt, als Schriftsteller ist es gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, der Effekt ist indirekt. Ich hatte in Barcelona zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben eine Gruppe von Freunden, die ich innig geliebt habe. Davor war ich ja eher einsam, weil ich nach der Schule nicht studiert hatte, sondern nur arbeitete (tagsüber) und schrieb (nachts) und in einer winzigen Bruchbude lebte, mit Dusche in der Küche. Ich wollte damals unbedingt Schriftsteller werden und mir diesen Traum erfüllen, wurde aber viele Jahre lang nur abgelehnt und war in dieser Phase eher allein. In Barcelona habe ich dann mit Mitte zwanzig versucht, die verlorene Zeit nachzuholen. Und vielleicht landete viele Jahre später etwas von diesem Gefühl in Hard Land, wenn Sam nach einer eher einsamen Zeit zum ersten Mal auf eine Gruppe Freunde trifft, bei denen er sich zu Hause fühlt.
Hatten Sie Kontakt mit dem katalanischen Übersetzer Ramón Farré? Was hat er Ihnen über Ihre Bücher und seine Erfahrung beim Übersetzen mitgeteilt?
Ramón und ich hatten ein sehr schönes Treffen im Rahmen der Übersetzung von Vom Ende der Einsamkeit. Da haben wir uns intensiv ausgetauscht. Und auch rund um Hard Land schrieben wir ein paar Mal, weil er Fragen zum Roman und bestimmten Begriffen hatte. Leider konnte ich damals in der Pandemiephase nicht nach Barcelona kommen, das hatte ich eigentlich vorgehabt. Umso mehr freue ich mich auf eine zukünftige Gelegenheit. Als Autor bin ich zutiefst dankbar für seine Arbeit und dass meine Geschichten übersetzt werden. Ich weiß, wie wichtig Katalanisch ist, wie viel diese Sprache den Menschen in Barcelona bedeutet, oft auch Identität und Heimat stiftet. Umso mehr bin ich froh, dass es einige meiner Romane auch auf Katalanisch gibt.
Algunes recomanacions...
© Copyright Associació Cultural Mentrimentres, 2023 | Desenvolupament web per Pol Villaverde